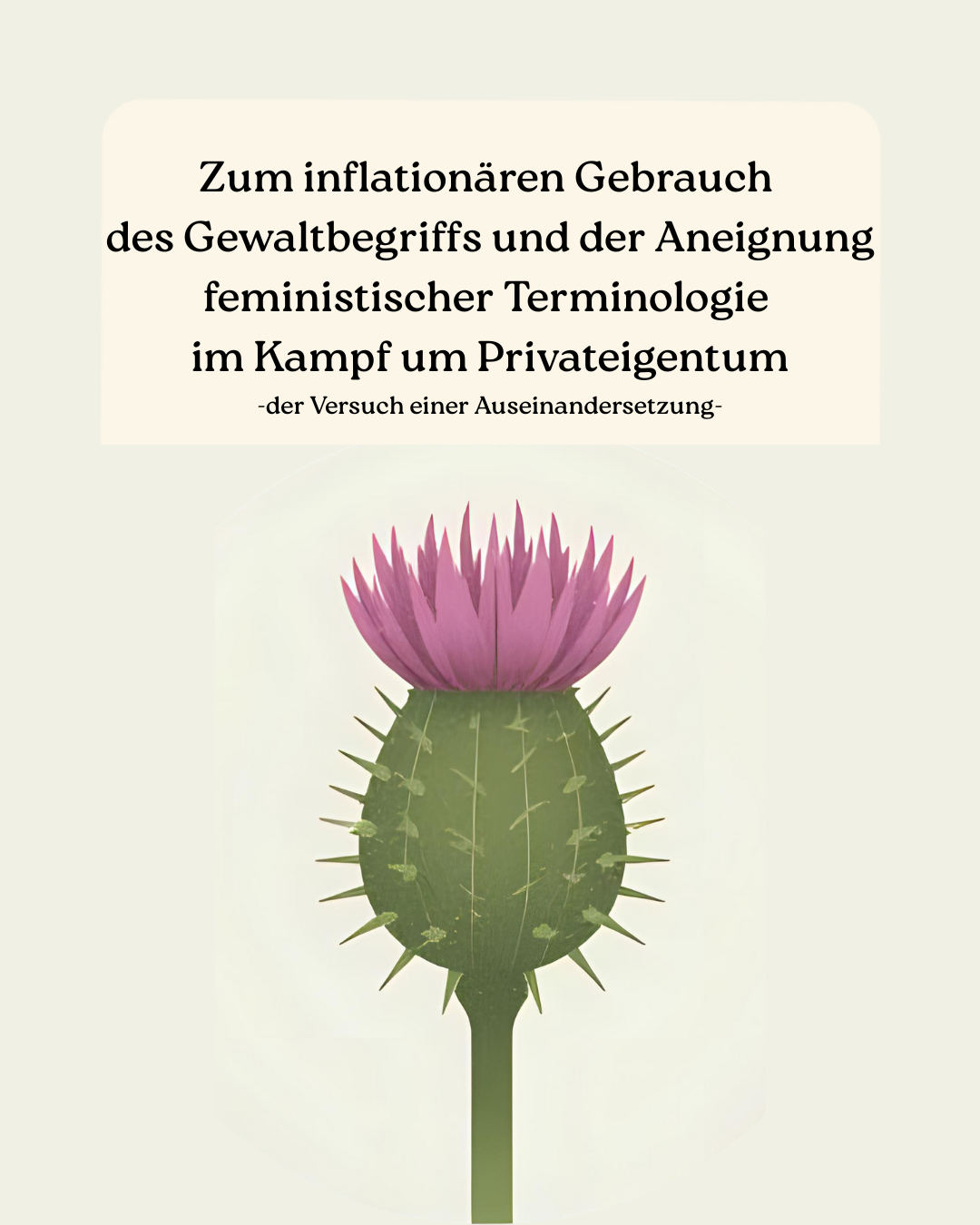-Der Versuch einer Auseinandersetzung-
Im Laufe des Konfliktgeschehens in der RM16 sahen wir uns mit unterschiedlichen Vorwürfen konfrontiert. Den meisten nahmen und nehmen wir uns an, indem wir versuchen unser Verhalten und unsere Positionen kritisch zu hinterfragen und zu diskutieren. Darunter waren aber auch Anschuldigungen, die uns zum Teil schlicht absurd erschienen: Wir seien „autoritäre Anarchist*innen“, würden im Sinne unserer trotzkistischen Vorbilder „entristisch“ das „letzte antideutsche Hausprojekt Dresdens“ übernehmen. Zuerst wurden wir öffentlich und im Internet des Antisemitismus bezichtigt. Nachdem dies nicht den gewünschten Effekt erzielt hat, wurde einfach die Erzählung verändert: Schließlich wurde ein Text veröffentlicht, in dem unser Genosse „Quentin“ öffentlich als „Täter“ diffamiert und wir als „Täterschützer*innen“ bezeichnet wurden.
Der Vorwurf, wir würden in trotzkistischer Manier das Eigenheim einer glücklichen Kleinfamilie übernehmen, war nie mehr als eine Provokation. Das ist sowohl uns, als auch den Urheber*innen dieser Anschuldigung bekannt. Darum hielten wir es nicht für notwendig, uns in dieser oder anderer Form zu äußern. Die immer wieder erhobenen Gewaltvorwürfe, die häufig vage bleiben und Raum für beliebige Interpretationen lassen, markieren für uns mittlerweile jedoch eine Grenze. An diesem Punkt halten wir eine Stellungnahme unsererseits für notwendig.
Wir, das ist eine Gruppe aus Menschen mit verschiedenen Hintergründen und Positionierungen. Die meisten von uns sind FLINTA*, wir sind alle weiß, manche von uns sind nicht in Deutschland aufgewachsen.
Wir haben vor allem aus zwei Gründen entschieden, uns zu den Anschuldigungen einzulassen.
Erstens: Die Vorwürfe, um die es hier geht – und wir möchten das an dieser Stelle unmissverständlich klarstellen, sind erfunden und unwahr. Sie verursachen auf persönlicher und individueller Ebene Leid und Schmerz. Unser Freund, Genosse und Mitbewohner sieht sich Behauptungen ausgesetzt, die nicht der Wahrheit entsprechen, deren bloße Existenz jedoch ausreicht, um Misstrauen und Unbehagen zu erzeugen – sowohl bei ihm selbst als auch in seinem sozialen und politischen Umfeld.
Zweitens: Diese Vorwürfe haben nicht nur Auswirkungen auf Einzelpersonen, sie haben Potential uns als Bewegung, uns als emanzipatorische Linke zu schwächen und sogar ganz erheblichen Schaden zuzufügen.
Anderen Menschen Gewalt- und „Täter“vorwürfe zu machen, diese für persönliche Interessen zu instrumentalisieren und damit nicht zuletzt von eigenem problematischem Verhalten abzulenken, in einem Konflikt, in dem es eigentlich um ganz anders gelagerte Differenzen geht, ist gefährlich. Begriffe wie „Täterschützer*in“ zu instrumentalisieren schadet dem Kampf gegen tatsächlich existente patriarchale Gewalt und Machtdynamiken innerhalb unserer Strukturen. Und auch das soll an dieser Stelle gesagt sein: Wir haben ein Problem in dieser Szene. Wir sind nicht frei von problematischen Machtdynamiken, wir alle sind im Patriarchat aufgewachsen, bewegen uns täglich darin und reproduzieren es entsprechend.
So ist es unredlich und alles andere als emanzipatorisch oder „links“, in einer Situation, in der es nicht mehr gelingt die eigene (tatsächlich mehrheitlich privilegierte Macht-)Position durch Argumente oder Tatsachen zu stützen und zu legitimieren, die andere Position mit Nebelkerzen in Form von Vorwürfen zu delegitimieren, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht einfach ausgeräumt werden können und eine längere Debatte erfordern. Allein die Beliebigkeit, mit der unterschiedlichste Vorwürfe (Trotzkismus, autoritärer Entrismus, Antisemitismus, Antifeminismus) vorgebracht werden, scheint bei näherer Betrachtung schlicht absurd. Und trotzdem stehen sie im Raum, schaden uns und müssen irgendwie behandelt werden.
In unserer Auseinandersetzung mit den Gewaltvorwürfen gegen eine Person aus unseren Reihen, ergab sich für uns vor allem die Frage, wie wir uns wehren können gegen Lügen, Manipulation und Kontrollverhalten einiger weniger gegenüber einer ganzen Gruppe. Wie wir uns gegen ausgedachte Vorwürfe zur Wehr setzen können, ohne dabei eigenes tatsächlich problematisches Verhalten zu übersehen. Als Anarchist*innen wissen wir, dass eine Analyse von Gewalt immer mehrere Perspektiven miteinbeziehen sollte und in jedem Fall Komplexität und Widersprüche aushalten muss. Machtverhältnisse stellen sich selten eindimensional dar. Menschen können aus unterschiedlichen Positionen Macht ausüben, diskriminiert werden oder von Diskriminierung betroffen sein.
Es ist unser unverrückbarer feministischer Anspruch an uns und unsere politische Arbeit Gewaltvorwürfen und insbesondere Vorwürfen sexualisierter Gewalt, die im Prozess der ganzen Anschuldigungen mindestens anklangen, wenn auch selten explizit, mit einem offenen und klaren Umgang zu begegnen. Nachdem wir uns als politischer Zusammenhang während der letzten Jahre z.T intensiv mit dem Thema kollektive Verantwortungsübernahme im Kontext von sexualisierter Gewalt befasst haben, wissen wir, wie anspruchsvoll und komplex eine ernsthafte Auseinandersetzung mit diesem Thema ist und sein muss.
Wir müssen Gewalt und gewaltvolles Verhalten benennen und kritisieren. Dort wo es stattfindet. Zu recht führen Gewaltvorwürfe und Anschuldigungen von patriarchalem Verhalten in der ersten Reaktion zu Empörung. Das ist richtig und soll so bleiben. Dafür müssen wir diese Vorwürfe jedoch differenziert ansetzen und vor allem nur dort anbringen, wo es die Tatsachen und Umstände begründen. Andernfalls wird eine wahrhaftige und ernsthafte Auseinandersetzung mit problematischen Verhalten und Machtdynamiken innerhalb unserer Strukturen mindestens sabotiert, wenn nicht sogar verunmöglicht.
Wenn also aus einem Konflikt, in dem sich ein cis Mann und eine FLINTA*-Person anschreien, der Mann sei in jedem Fall als „Täter“ konstruiert wird und in dieser Situation einzig der Gewaltausübende sein muss, scheint uns das zu unterkomplex. Es wird weder der spezifischen Situation gerecht, da der Prozess, der zu dieser geführt hat nicht betrachtet wird, noch unserem feministischen Anspruch, Personen vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Positionierung und der damit einhergehenden Machtdynamik zu begreifen.
Die aktuelle Situation um das Hausprojekt zeigt einmal mehr, dass wir nach wie vor keine ausreichenden Handlungskonzepte und Ideen haben, wie wir mit Gewalt innerhalb unserer Strukturen umgehen. Gleichermaßen fehlen uns Konzepte wie wir uns vor der Instrumentalisierung feministischer Standarts und Strukturen schützen können. Es mangelt an der Einsicht, dass diese Themen nicht nur von Betroffenen und solidarischen Menschen bearbeitet werden muss, sondern von Allen. Wir brauchen gemeinsame Konzepte, die vor allem bereits auf Prävention setzten, um diese patriarchalen Handlungsmuster zu durchbrechen.